Wahlkampfprogramme gehören nicht gerade zur aufregendsten Bettlektüre. Nebst leeren und auf Hochglanz polierten Versprechungen und finanziellen Verlockungen für den Ausbau aller möglichen und unmöglichen Sozialprojekte bieten sie selten alternative Angebote. Im aktuellen Wahlkampf-Sprint lässt jedoch das Wahlprogramm der AfD aufhorchen. Deshalb fragt KONTRAFUNK direkt an kompetenter Stelle nach bei Nicole Höchst. Sie ist bildungspolitische Sprecherin der AfD im Deutschen Bundestag.
Herzlich willkommen, Frau Höchst!
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich grüße Sie und viele Grüße an die Zuhörer.
Sie sind seit vielen Jahren Leiterin des Bundesfachausschusses 6 der AfD, also für die Bildung auch zuständig. Zudem sind Sie ehemalige Studienrätin und waren Referentin am Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz. Und ganz wichtig: Sie sind Mutter von vier Kindern.
Beginnen wir mit einer sehr pronunzierten Stellungnahme von Ihnen, die ich gelesen habe, und ich erlaube mir an dieser Stelle einmal zu zitieren: „Wir lehnen die bundesstaatlich geförderte Ökonomisierung, Zentralisierung und Globalisierung unserer Universitäten und Schulen ab.“ Zitat Ende.
Das beinhaltet natürlich sehr viel Diskussionsstoff. Beginnen wir mit dem Wort „Ökonomisierung“ der Unis und Schulen. Was meinen Sie damit?
Das ist ein sehr vielschichtiger Begriff. Vielen Dank für das Zitat. Das war der Versuch, in aller Kürze sehr viel zu sagen, und das muss man natürlich aufbohren. Ökonomisierung ist in mehrerlei Hinsicht ein wichtiges Schlagwort. Denn zum einen wird natürlich auch in der Bildungsindustrie sehr viel Geld verdient.
Da müssen wir zunächst mal an die Schulen schauen. Dort sind die Lehrmittel, die Schulbücher, aber auch die Testindustrie. Dort verdient man sehr viel Geld. Bildung ist zur Handelsware geworden, bei der viele Leute mitverdienen.
Das andere, und das ist uns von der AfD noch sehr viel wichtiger, ist, dass die Bildung an sich immer mehr einem Input-Output-System gleichkommt. Seit der Umstellung auf die Bildungsstandards und der Kompetenzorientierung bedeutet das, dass man von der Vorstellung ausgeht, dass man etwas in diese Schüler hinein gibt, dann passiert etwas in dieser Blackbox, und am Ende soll eine Leistung herauskommen, eine Kompetenz aufgezeigt und ausgewiesen werden, die dann auch mit standardisierten Korrekturverfahren gut ausgewertet werden soll.
Das halten wir für schwierig, weil wir Bildung eher im humanistischen Sinne sehen. Also wir möchten, dass Schüler denken lernen, selbstständig denken lernen, bewerten, einordnen, vernetzen, reflektieren und anwenden. Natürlich ist das etwas, das über diesen reinen Kompetenzbegriff sehr deutlich hinausgeht und was im Grunde genommen nach humanistischer Vorstellung auch die Schüler letztendlich dazu befähigt, mündige Staatsbürger zu werden.
Deswegen ist uns das so wichtig. Wir wollen Schüler nicht maschinenähnlich sehen und die Bildung eben auch nicht in ein Fahrwasser kommen lassen, wo man Schüler wie Maschinen füttert und dann auch eine erwartbare Kompetenz als Leistung herausgegeben bekommt.
Nun hört man aber immer wieder aus der Wirtschaft auch das Argument, ja, die Schüler würden mit so viel Stoff konfrontiert und abgefüttert, sozusagen, den sie dann nachher im Berufsleben gar nicht unbedingt brauchen können. Viele Wirtschaftsvertreter fordern ja gerade diese Kompetenzorientierung. Was sagen Sie denn diesen Leuten?
Ja, das sind natürlich zwei Seiten der gleichen Medaille. Natürlich müssen Schüler auch Dinge können, wenn sie von der Schule kommen, die für die Wirtschaft verwertbar sind. Da sehe ich allen voran die Kernkompetenzen, die Grundfähigkeiten und Fertigkeiten: Lesen, Schreiben, Rechnen.
Das ist ja etwas, was auch die Testindustrie immer wieder versucht nachzuweisen mit ihren standardisierten Tests. Gehen wir mit dem Niveau rauf? Aber nein, wir gehen seit Jahren grundsätzlich hinunter. Also noch mal: Wir bilden ja Schüler nicht aus für irgendeinen Verwendungszweck. Dann könnte man auch Roboter herstellen und die an eine Stelle in der Industrie setzen und den Betrieben übergeben.
Sondern wir bilden ja Menschen aus, Menschen, die befähigt werden sollen, ihr Leben zu einer persönlichen Zufriedenheit zu führen, einen Beruf zu erlernen und zu wählen und glücklich sein zu können. Das können wir nicht, wenn wir rein den Verwendungszweck von Menschen im Auge haben. Das finden wir ganz furchtbar.
Gehen wir zum zweiten Begriff der Zentralisierung. Hier setzen Sie ja auch Ihre Kritik an zentralisierten Unis und Schulen. Was meinen Sie damit?
Wir sehen seit Jahren die Bestrebung, auch mittels des Digitalpaktes die Axt an das Föderalismusprinzip zu legen. Wir halten es für gut, wenn ein Wettbewerb zwischen Bundesländern besteht. Wettbewerb ist immer gut, vor allen Dingen, wenn man sich dann nach oben strecken muss und nicht den Wettbewerb im Niveau absucht.
Wenn wir mehr zentralisieren, das ist unsere feste Überzeugung, dann gibt es auch wieder mehr Möglichkeiten, vom Bund aus in die Länder und damit auch in die Schülerhirne hineinzugreifen. Das finden wir schon ganz unsäglich. Mit einigen Bundesprogrammen, die dazu angetan sind, Schüler mehr zu indoktrinieren als sie zu bilden, glaube ich, hat das schon einen Grund, warum man die Bildung in der Hand der Länder gelassen hat.
Vor allen Dingen nach diesen schrecklichen 12 Jahren hat man gesagt, wir wollen nie wieder, dass es möglich ist oder so leicht möglich ist, eine Ideologie vom Bund in die Köpfe von Kindern und Schülern durchzureichen.
Also das wollen wir nicht. Wenn gleich wir natürlich sehen, dass es insgesamt Schwierigkeiten gibt. Die Bildungsbudgets sind nicht so verteilt in den Ländern und Kommunen, dass die Schulen da irgendeine Priorität hätten.
Die Schulklos sind ja immer dieses Beispiel. Manche Großeltern, die ihre Kinder in manchen Grundschulen abholen, sehen dort immer noch die gleiche Sanitärausstattung wie quasi nach dem Krieg.
Also da muss mehr investiert werden. Ob das gut ist, das zentralistisch zu machen? Ja, wenn es gar nicht anders geht, sage ich mal ganz pragmatisch. Aber das ist nicht unsere Lieblingslösung.
Chancenförderung und Ideologisierung
Sie haben jetzt Programme angesprochen auf Bundesebene. Da gibt es ja dieses Chancenförderprogramm, das sich konzentriert auf Brennpunktschulen. Wieso sehen Sie dort eine Gefahr der Ideologisierung, dann letztendlich in den Schulen oder in den Köpfen der Kinder?
Das Chancenprogramm ist keines dieser Indoktrinationsprogramme. Da ist eher „Demokratie leben“ ein gefährliches Programm oder „Schule gegen Rassismus“, „Schule mit Courage“. Diese Dinge, aber auch die Frühsexualisierung, die vom Ministerium für Familie ausgereicht wird, das sind die Programme, die schwierig sind für uns in der Fläche.
Und die kommen eben aus dem Bund. Das Chancenprogramm finden wir nicht genug. Wir haben diese Probleme. Warum das Chancenprogramm aus der Taufe gehoben worden war von der Regierung, war ja, dass wir immer weniger deutschmuttersprachliche Schüler an Schulen haben.
Darüber hinaus haben wir ganz häufig schlimme Zustände mit Aggressionspotenzial, was ungekannt ist von vor 20 Jahren. Diese Brennpunktschulen, aus Rheinland-Pfalz könnte ich Ihnen jetzt die Grevenuschule in Ludwigshafen nennen, wo einfach sehr viele Kinder nicht deutschmuttersprachlich sind und im dritten Jahr infolge 44 Kinder, glaube ich, diesmal sitzen geblieben waren im letzten Durchgang. Das ist so nicht hinzunehmen.
Ja, und die Regierung hat gesagt, wir brauchen dann diese besonderen Schulen, die dann besonders ausgestattet sind, um da entgegenzuwirken. Wir haben uns vehement gegen diese Art der Problemlösung gewehrt, weil das einfach zu wenig Schulen betrifft und auch in Rheinland-Pfalz nicht funktioniert hat.
Die Frau Ministerin Hubig hat ja in Rheinland-Pfalz auch schon die Dinge für die Grevenuschule auch ausgelobt, die jetzt in diesem Chancenprogramm als Himmelreich propagiert werden, und es hat nicht funktioniert. Wir sind nicht müde geworden, das aufzuzeigen, aber man wollte nicht hören.
Und jetzt haben wir diesen Salat, dass das eigentliche Ursprungsprogramm in der Fläche persistiert bleibt, dass die Bildung weiterhin nicht mehr stattfinden kann wie noch vor 20 Jahren, als noch die Mehrheit deutschmuttersprachlich war.
Das heißt, hier müsste man Ihrer Meinung nach dann mehr Geld noch reinschießen oder wo sehen Sie erste wichtige Schritte, die man eigentlich sofort umsetzen müsste?
Also der aller wichtigste Schritt wäre jetzt einzusehen, dass es so nicht funktionieren kann, dass der Bund nach wie vor die Grenzen offen hält und einen weiteren Zustrom nach Deutschland ermöglicht von Leuten, die wir vorher in der Planung für die Schulen nicht auf dem Zettel haben konnten.
Das ist ja ganz klar. Ja, also wir haben so viele Kinder jetzt aus der Ukraine zusätzlich an die Schulen bekommen, dass wir den Lehrermangel verschärft haben. Wir haben aber auch sehr viele Kinder aus dem Arabischen Kontext zusätzlich an Schulen bekommen, die alle auch kein Deutsch verstehen.
Und damit möchte ich einfach sagen, dass als allererstes jetzt geschaut werden muss, dass diese Kinder, die zusätzlich in die Regelschulen gesetzt werden, weil ja Bildungspflicht ist, das ist ja richtig so, dass diese zunächst einmal die Landessprache Deutsch lernen. Denn ohne die deutsche Sprache, die ja der Schlüssel zur Integration ist, können die im Unterricht nicht folgen und werden diese Misserfolgserlebnisse wieder und wieder haben.
So macht man das. Weiß jeder Pädagoge: Kinder, die abgehängt werden, die den Glauben an sich verlieren und die eben keine Motivation mehr aufweisen, werden hier in Deutschland überhaupt sich bemühen für irgendwas. Also das ist grundfalsch, das muss aufhören.
Die Kinder, die kein Deutsch können, müssen zunächst einmal separat unterrichtet werden, um anschließend eine Chance zu haben. Und das ist etwas, was der Bund regeln muss. Es ist völlig unfair, die Länder vor diese Situation zu stellen, dass mit dem Königsteiner Schlüssel weitere Verteilungen von Zuwanderern und Flüchtlingen vorgenommen werden und dann müssen die Länder gucken, wie sie zurechtkommen.
Das Thema mit dem Lehrermangel ist ja auch nicht neu. Lehrermangel haben wir, ach Gott, schon vor, ich glaube, 40, 45 Jahren im Bundestag besprochen und da waren die Zustände noch planbar. Da hat man aufgrund der demografischen Entwicklung planen können, wie viele Kinder werden denn, wenn die 1970 geboren werden, 1976 in die Schulen eintreten und so weiter. Das konnte man alles planen, und dennoch gab es auch damals schon Lehrermangel.
Wissen Sie, es sind so viele Sachen in den letzten Jahren in die Schullandschaft gedrückt worden, abgesehen von der Kompetenzorientierung und der Inklusion um jeden Preis, dass das staatliche Bildungssystem von allen Seiten angeschossen ist, wenn ich mal in diesem Bild bleiben darf.
Hilft es eben auch nicht, wenn man zusätzlich noch Kinder hineinsteuert, die gar kein Deutsch sprechen. Also das deutsche Schulsystem, wenn jetzt nicht ganz, ganz schnell tatsächlich wirksame Maßnahmen ergriffen werden, ist tot.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, wäre das sicherlich einer der allerersten Hebel, an denen Sie ansetzen würden, wenn jetzt z.B. die AfD wirklich in Regierungsverantwortung käme.
Wir haben jetzt über den Bereich der Ökonomisierung und der Zentralisierung gesprochen. Ich würde gerne noch auf diesen dritten Punkt zu sprechen kommen, weil man den nirgends sonst liest. Sie kritisieren ja auch hier eine Globalisierung der Unis und der Schulen. Wenn Sie uns da Ihren Gedanken noch äußern könnten, bitte.
Ja, Globalisierung ist auch immer ein zweischneidiges Schwert. Natürlich lebt die Wissenschaft vom Austausch, und das ist nicht das Problem. Wenn nicht über globale Thinktanks eben Richtungen vorgegeben werden, die zum Drittmittel einwerben, dann plötzlich notwendig werden.
Das Thema Genderwissenschaften würde ich an dieser Stelle gerne mal einspielen. Das ist ja groß geworden. Ich glaube, als ich 2017 zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen bin, gab es 235 Genderlehrstühle. Wie viele es jetzt sind, wäre interessant noch mal zu eruieren. Eher mehr als weniger.
Diese Genderwissenschaft hat sich auch aus den USA kommend in den deutschen Hochschulmarkt gedrängt. Man kann dort sehr gut, in Anführungszeichen, Wissenschaft schaffen, die schon mal auf einer unwissenschaftlichen Prämisse beruht. Wenn ich mir den Ideengeber dieses Wissenszweiges, ich sage das ein bisschen verächtlich, anschaue, der aus seiner statistischen Menge n=2 seine Thesen abgeleitet hat, das ist natürlich kompletter Humbug.
Das weiß eigentlich auch jeder echte Wissenschaftler. Und dennoch sehen wir, dass das eine gepäppelte Wissenssparte ist an Universitäten. Diese Leute haben dann Posten zu erwarten in den Parteien, die so etwas fördern, in den Stiftungen, die so etwas fördern.
Also das ist im Grunde genommen ein sich selbst weiter befruchtendes System, und das ist ein global eingespieltes Thema. Das ist aber nur eine Seite der Problematik. Die andere Seite der Problematik, die wir sehen, ist, dass unser Wissenschaftssystem weltweit unwahrscheinlich anerkannt war in Zeiten, ich sage mal, Staatsexamen, in Zeiten Diplomstudiengänge.
Das waren wirklich Dinge. Ein deutscher Diplomingenieur mit einem solchen Studiengang konnte sich weltweit alles aussuchen. Und die Umstellung auf das Bachelor- und Master-System hat zur Folge, dass dort eine sehr starke Angleichung stattgefunden hat. Man sagte zur Vereinfachung von Wechseln und Anerkennung von Studienleistungen: Ja, vielleicht, vielleicht ist es besser geworden.
Auf der anderen Seite, ich habe das schon öfter dargestellt, und vielleicht der eine oder andere, der vor 20 Jahren studiert hat, wird mir noch recht geben: Diese Angleichung ist nicht nur gut, weil wir jetzt ein ganz verschultes System haben. Neigungsstudien, die ja persönliche Wissenschaftskarrieren aufgewertet haben, wenn man z.B. mal vier Lehrstunden hatte im Stundenplan, konnte man, wenn man auf Lehramt studiert hat, beispielsweise Psychologie-Veranstaltungen besuchen, Proseminare besuchen, Scheine dort machen oder bei Philosophie oder oder oder.
Durch diese persönlichen Interessensschwerpunkte sind auch sehr interessante Wissensbiografien zustande gekommen. Man konnte vernetzen und wesentlich stärker individuell sich ausprägen. Und wenn ich das so höre bei Leuten, mit denen ich darüber rede, auch sehr viel besser Wissenschaft vernetzen, schneller vernetzen, als wenn jetzt alle im Gleichschritt durch so ein Studium gehen.
Das ist sehr schade. Damit wären wir auch wieder beim Bildungsbegriff, den Sie schon erwähnt haben am Beginn unseres Gesprächs. Eine umfassende Bildung, die auch in den Universitäten durch diesen Systemwechsel so nicht mehr gegeben ist.
Was wir aber auch immer wieder hören, ist, dass sich die Frage stellt: Haben wir eigentlich zu viele Studenten überhaupt an den Universitäten? Mal abgesehen von dem Bildungsangebot, werfen wir noch den Blick auf diese Seite: Sehen Sie die Abiturquote in Deutschland zu hoch?
Ja, sie ist in jedem Fall zu hoch. Wir haben, als die Alternative für Deutschland aus der Taufe gehoben wurde vor vielen Jahren, schon gesagt, dass dieser Akademisierungswahn, war unser Begriff, einfach nicht gut ist. Wenn immer mehr Leute ein Abiturzeugnis aufweisen können, dann liegt der Verdacht nah, dass einfach die Abiturleistung ja entwertet wird bis zu einem gewissen Grad.
Und das habe ich eben auch feststellen dürfen, als ich für die Landesregierung in Berlin beim IB war und beraten habe für die Vergleichsstudien und aber auch für die Bildungsstandards, dass dort einfach die Standardisierung zu einem Absenken des Niveaus geführt hat und eben nicht zu einer Niveauabsicherung auf einem hohen Standard.
Das sehe ich sehr kritisch. Generell sind diese Dinge zu beobachten, dass einfach Menschen sagen: Du musst studieren, wenn du in deinem Leben irgendwas machen möchtest. Den Kindern wird vorgegaukelt, sie könnten anders den Weg zum Glück gar nicht finden.
Es könnte aber grundfalscher nicht sein. Also ich kann nur empfehlen, sich wirklich noch mal zu überlegen, dass wir Handwerk haben, goldenen Boden, früher einmal gesagt haben. Und das ist ja auch so. Wenn wir noch 10 Jahre weitermachen wie bisher, dann sehen wir die Situation, dass ganz viele Akademiker zu Hause sitzen und frieren, weil der einzige Installateur, den es noch gibt, das Terminbuch so voll hat, dass man wochenlang warten muss, bis man den Heizungsschaden behoben bekommt.
Also das kann natürlich nicht sein. Und dieses Herabsehen auf Berufe, wo man sich vielleicht die Hände schmutzig macht, das muss wirklich aufhören. Aber ich denke, das regelt der Markt spätestens in 10 Jahren.
Aber wie müsste man genau an dieser Stelle konkret dann auch die Berufsbildung stärken? Sie sprechen einen Mentalitätswandel an, aber was kann die Politik hier machen?
Die Politik hat im Zuge der Diskussion und der sogenannten Bildungsgerechtigkeit das Abitur für alle durchgedrückt. Ich bin auch sehr dafür, dass jedes Kind die Chance haben soll, ein Abitur zu machen, damit es nicht nach Schichtsystem da geht und sich immer die gleichen Schichten weiter herausbilden.
Aber diese Bildungsgerechtigkeit, die gibt es ja schon. Wir müssten jetzt wieder hingehen und sagen, dass die gleichwertig noch sehr viel stärker betont werden muss, dass die Berufsaussichten beispielsweise im handwerklichen Bereich, aber auch im Bereich der Pflege super sind. Also noch nie so gut gewesen sind wie derzeit.
Also wer im Moment dort eine Lehre aufnimmt und die mit Bravour abschließt, der fängt mit Lohnzetteln an, da habe ich als junge Lehrerin in den frühen 2000ern von geträumt. Also das sind große Gehmöglichkeiten. Da sind große Selbstverwirklichungsdinge möglich. Man kann ganz tolle Karrieren dorthin legen, eigene Firmen gründen, großen Wohlstand schaffen, sich wahrscheinlich wesentlich besser Familie, Auto, Urlaub, Häuschen und so weiter leisten wie jemand, der jetzt in die Geisteswissenschaften eintritt, um irgendwas mit Gender oder Klima oder sonst wie zu studieren.
Denn einfach der Markt sagt, wir brauchen diese Leute. Und ich glaube, wenn jemand sagt, ich möchte glücklich sein und ich möchte Familie haben und ich möchte mir einen bescheidenen Wohlstand schaffen, dann kann es gut sein, dass er, wenn er handwerkliche Fähigkeiten z.B. hat oder gerne mit Menschen arbeitet, gerade dort eine Berufung findet, die ja dann lebenslang ausbauen kann.
Das macht ja sehr zufrieden, wenn man etwas machen kann, was einem Spaß macht.
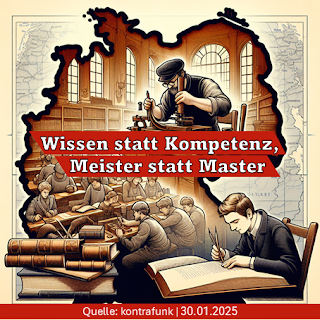
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen